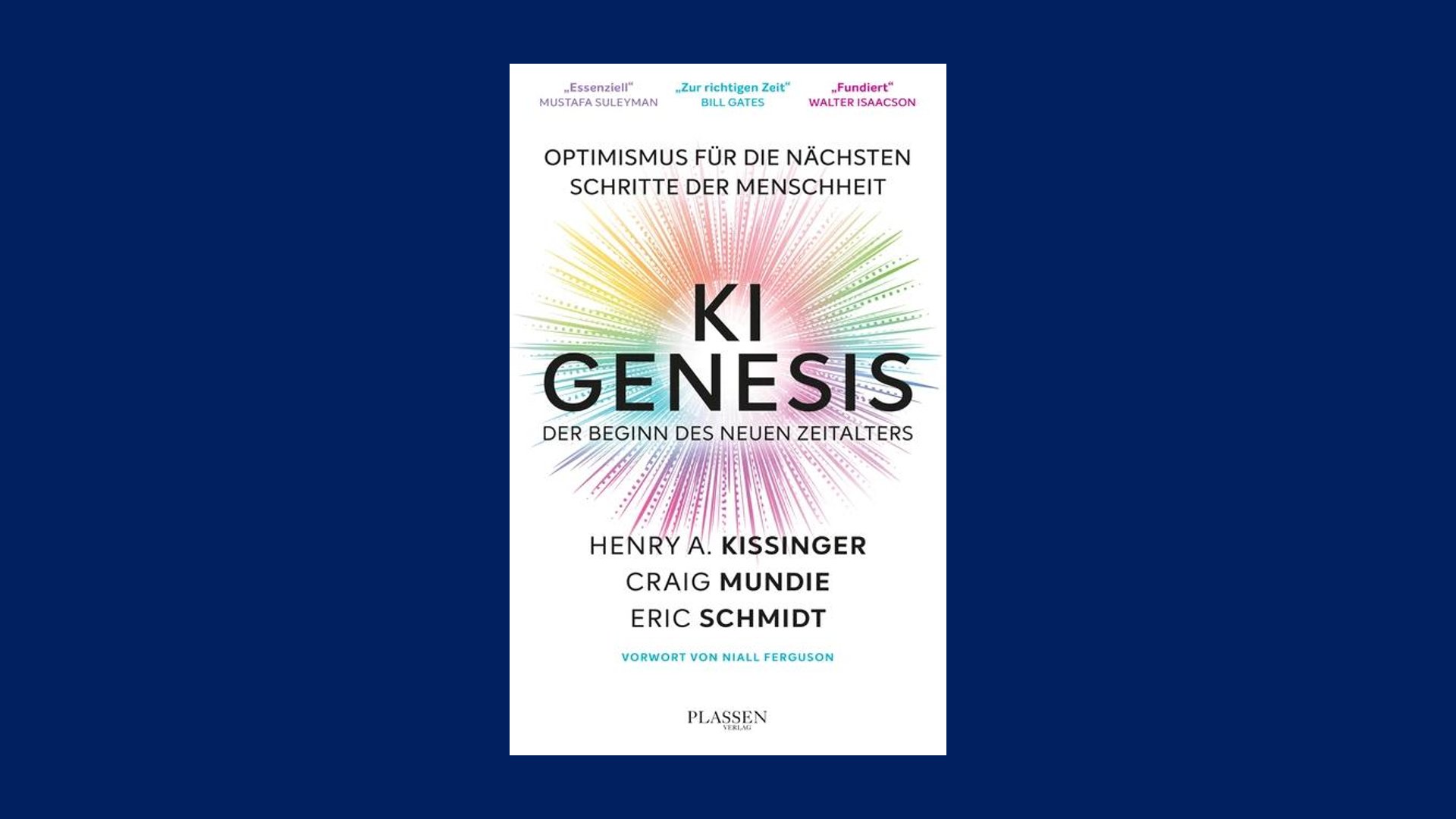Von Ralf Keuper
Neue Technologien bringen für gewöhnlich große Herausforderungen für Institutionen, Unternehmen, Gesellschaften wie auch für das Verhältnis der Staaten untereinander mit sich—die Gewichte verschieben sich. Mit der modernen KI ergeben sich neue Konstellationen und Chancen, aber auch Risiken, die nach neuen Antworten und Denkansätzen verlangen.
Zum Ende seines Lebens setzte sich Henry A. Kissinger intensiv mit der Frage auseinander, inwieweit die moderne KI den Lauf der Geschichte beeinflusst. Kissinger war der Ansicht, dass das Aufkommen der KI eine neue Epoche in der Geschichte einleiten werde, die in ihren Auswirkungen mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts vergleichbar sei, da sie das menschliche Denken auf tiefgreifende und unerwartete Weise verändern kann. Die größte Gefahr bestand für ihn darin, dass wir zu früh oder zu vollumfänglich erklären, dass wir sie verstehen.
Seine Co-Autoren, Eric Schmidt, ehemaliger Chef von Google, und Craig Mundle, langjähriger Chief Research and Strategy Officer von Microsoft, setzen die Gedankenarbeit von Kissinger in dem Buch KI-Genesis. Der Beginn eines neuen Zeitalters fort.
KI als ultimativer Universalgelehrter
In der Vergangenheit waren Universalgelehrte wie Leibniz oder Leonardo da Vinci in der Lage, den Wissensstand ihrer Zeit zu überblicken. Daneben gab es sicherlich noch weitere gelehrte Menschen mit breitem Wissen, die jedoch kaum Beachtung fanden, da die Möglichkeiten zum Austausch aus vielerlei Gründen stark eingeschränkt waren. Häufig wussten sie nichts von der Existenz der anderen und ihren Forschungen. Spätestens mit der KI sind die alten Beschränkungen angehoben. Die KI kann Unmengen von Informationen in atemberaubender Geschwindigkeit verarbeiten und darstellen. Dabei bewertet sie Muster in zahllosen Dimensionen und Bereichen gleichzeitig und schafft so eine noch nie dagewesene Konnektivität, so Schmidt und Mundle. Die “Einheit des Wissens”, wie sie von dem Soziobiologen E.O. Wilson formuliert wurde, scheint in greifbarer Nähe. Dank der KI erreichen wir eine neue Stufe der kollektiven Intelligenz. Nationen, welche die Möglichkeiten der KI für neue wissenschaftliche Entdeckungen nutzen, werden die Nase vorn haben. Das wiederum kann neue Ungleichheiten zwischen den Staaten erzeugen und bereits bestehende verstärken.
Herausforderung für die menschliche Existenz
Wenn die KI den Menschen bei allen intellektuellen Fähigkeiten um ein Vielfaches übertrifft und demnächst womöglich auch noch kreativ und schöpferisch tätig ist, was macht dann noch die menschliche Existenz aus? Welche Rolle sollten die Menschen einnehmen—eine passiv-abwartende oder eine aktiv-gestaltende? Wieviel Autonomie sollten wir KI-Systemen zugestehen? Sollten wir sie aus ihrem algorithmischen Gefängnis befreien?
Weder ist die Haltung, den Maschinen gottähnliche Fähigkeiten zuzuschreiben und sich ihrer Führung zu unterwerfen eine sinnvolle Alternative, noch die Flucht in einen menschenzentrierten Subjektivismus, der das Potenzial der KI, irgendein Maß an objektiver Wahrheit zu erreichen, und KI-Aktivitäten verbietet. Die Autoren argumentieren, dass beide Sichtweisen dazu führen würden, die Evolution unserer Spezies zu verhindern.
Moderne Staatsführung mit KI
Der größte Nutzen der KI besteht darin, Szenarien zu ersinnen und zu durchdenken, auf die wir Menschen so oder so schnell nicht kommen würden. Das Ergebnis wären völlig neue Lösungen und Denkansätze, die sich in der Politik und Wirtschaft zur Entscheidungsunterstützung verwenden ließen. Die moderne Staatsführung kommt nach Ansicht der Autoren auf Dauer nicht mehr ohne den Einsatz der KI aus. Statt sich wie bisher auf historische Erfahrungen zu stützen, wird die KI mit ihrem nahezu perfekten Wissen das Feld der Möglichkeiten und der Folgenabschätzung deutlich erweitern. Dabei gelte es die richtige Balance zwischen den Extremen Despotismus und Anarchie zu finden.
Neue Formen des Wirtschaftens
Die Erfolge KI-gestützter Verfahren zur Entdeckung neuer Materialien und Wirkstoffe sind schon jetzt beachtlich. In Zukunft könnte die KI für die Erforschung und Entwicklung neuer und günstiger Rohstoffquellen, die überwiegend synthetischer Art sind. Im Finanzwesen sind neue Netzwerke denkbar, die sich an der Informationstheorie orientieren. Geld habe heute viel mit einer Internetverbindung gemeinsam, die, um Nutzen zu stiften, einen relationalen Kontext erfordert. Die KI könnte hier zwischen der traditionellen Funktion des Geldes als Wertaufbewahrungsmittel und Tauschmittel vermitteln.
Ebenso wird sich unser Verhältnis zur Arbeit als Mittel zur Sinnstiftung verändern. Eine Welt ohne menschliche Arbeit ist dank KI vorstellbar. Welche Betätigungsfelder bleiben auf Dauer noch für die Menschen? Denkbar ist, dass die Menschen sich dennoch dazu entscheiden, weiter zu arbeiten—allerdings mithilfe der KI als Partner. Erforderlich seien dazu Systeme für die Verteilung, Verbindung, Beteiligung und Bildung. Die Menschen würden dann nicht mehr gegen Bezahlung arbeiten, sondern um Stolz und Freude zu empfinden.
Symbiose von Mensch und Maschine
Mensch und Maschine könnten sich über den Einsatz entsprechender Schnittstellen gemeinsam weiter entwickeln. So könnte die Gesellschaft eine Erblinie entwerfen, die auf ihre Eignung für die Zusammenarbeit mit der KI zugeschnitten ist. Die Veränderung des genetischen Codes der Menschen durch KI könnte die Abhängigkeit der Menschen von der Technik erhöhen und uns irgendwann zu Sklaven machen. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen wir uns nach Ansicht der Autoren nach Alternativen umsehen.
Menschliche Regeln geben den Takt vor
Die Autoren verweisen auf die Bemühungen, KI-Modelle mit sog. Ground Truths, menschlicher Regeln, zu erden und zu verhindern, dass die Systeme sich verselbständigen. Daraus könnte ein Gesetzbuch der KI entstehen, das auf verschiedenen Verwaltungsebenen angesiedelt ist: auf lokaler, Bezirks‑, Landes‑, Bundes- und internationaler Ebene. Dabei könnten Präzedenzfälle, Rechtsprechung und wissenschaftliche Kommentare gleichzeitig berücksichtigt werden.
Ein anderer Ansatz stützt sich auf die Arbeiten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu, wonach unsere grundlegenden, instinktiven und universellen menschlichen Überzeugungen robuster und beständiger sind, als jede Regel, die durch Bestrafung durchgesetzt wird. Bourdieu wählte dafür den Begriff Doxa. Doxa repräsentieren einen Code menschlicher Wahrheit, der typisch für den Menschen ist, der aber nicht durch fest kodierte Artefakte dargestellt wird. Sie werden einfach beobachtet und im Laufe des menschlichen Lebens aufgenommen.
Jedenfalls müssten die KI-Systeme mit verschiedenen Regelwerken und Doxa trainiert werden.
Die Unternehmen könnten mit staatlicher Bewilligung und wissenschaftlicher Unterstützung “Geounding-Modelle” entwickeln. Weiterhin müssten eine Reihe von Validierungstests für die Zertifizierung eines Modells entwickelt werden. Eine Überwachungs-KI würde die Verwendung von KI-Agenten überwachen, die sich mit ihrem Überwacher beraten würden, bevor sie mit einer Aufgabe fortfahren. Laboratorien und gemeinnützige Organisationen könnten sowohl KI-Agenten als auch KI-Überwacher auf ihre Risiken hin testen und bei Bedarf zusätzliche Trainings- und Validierungssysteme empfehlen. Die Geounding-Modelle müssen mit den Agentenmodellen verbunden und diese ständig mit der neuesten Version des kuratierten Kodexes aktualisiert werden.
Menschliche Würde
Die eigentliche Grenze, die auch die ambitioniertesten KI-Projekte zu akzeptieren haben, ist die menschliche Würde. Die Autoren definieren Würde als eine Eigenschaft, die den Geschöpfen innewohnt, die verletzlich und sterblich und damit voller Unsicherheit geboren werden und trotz ihrer natürlichen Neigungen ihre Freiheiten ausüben können, nicht ihrer Vorstellung vom Bösen zu folgen, sondern ihre Vorstellung vom Guten zu wählen.
KI-Systeme besitzen demzufolge keine Würde. Sie werden nicht geboren, sie sterben nicht, fühlen weder Unsicherheit noch Angst und haben keine natürlichen Neigungen der Individualität. Zwar können sie Gefühle ausdrücken oder nachahmen—sie sollten jedoch wie literarische Figuren behandelt werden.
Die Autoren wünschen sich eine Zukunft, in der sich menschliche und maschinelle Intelligenz gegenseitig unterstützen. Dabei stützen sie sich auf den Glauben an die Menschenwürde, der sich zuversichtlich macht, dass sich Mensch und KI sinnvoll miteinander in Einklang bringen lassen.
Bewertung
Das Buch liefert wichtige Einsichten in den aktuellen Stand der KI-Entwicklung. Die Autoren betonen die Chancen der KI, ohne die potenziellen Risiken auszublenden. Sie vertreten einen moderaten Ansatz, der ganz klar für den Einsatz der KI auf möglichst vielen Feldern plädiert. Risiken müssen dabei in Kauf genommen werden. An einigen Stellen sind sie für den Verfasser etwas zu optimistisch—etwa, was die Möglichkeiten der KI in Sachen Kreativität und Schöpfung betrifft. Die Körperlichkeit des Menschen setzt den Bestrebungen der KI-Forschung, die menschliche Intelligenz und Schöpferkraft zu ersetzen,—bisher jedenfalls—Grenzen. Positiv ist zu werten, dass die Autoren den Begriff der Würde einführen, um zu verdeutlichen, was uns Menschen von KI-Systemen wesentlich unterscheidet. Ebenfalls zu begrüßen sind die Gedanken zur Einführung eines Regelwerkes, das ein Mindestmaß an Verlässlichkeit und Vertrauen in KI-Systeme herstellen kann.
Der Text als Podcast
Zuerst erschienen auf KI-Agenten