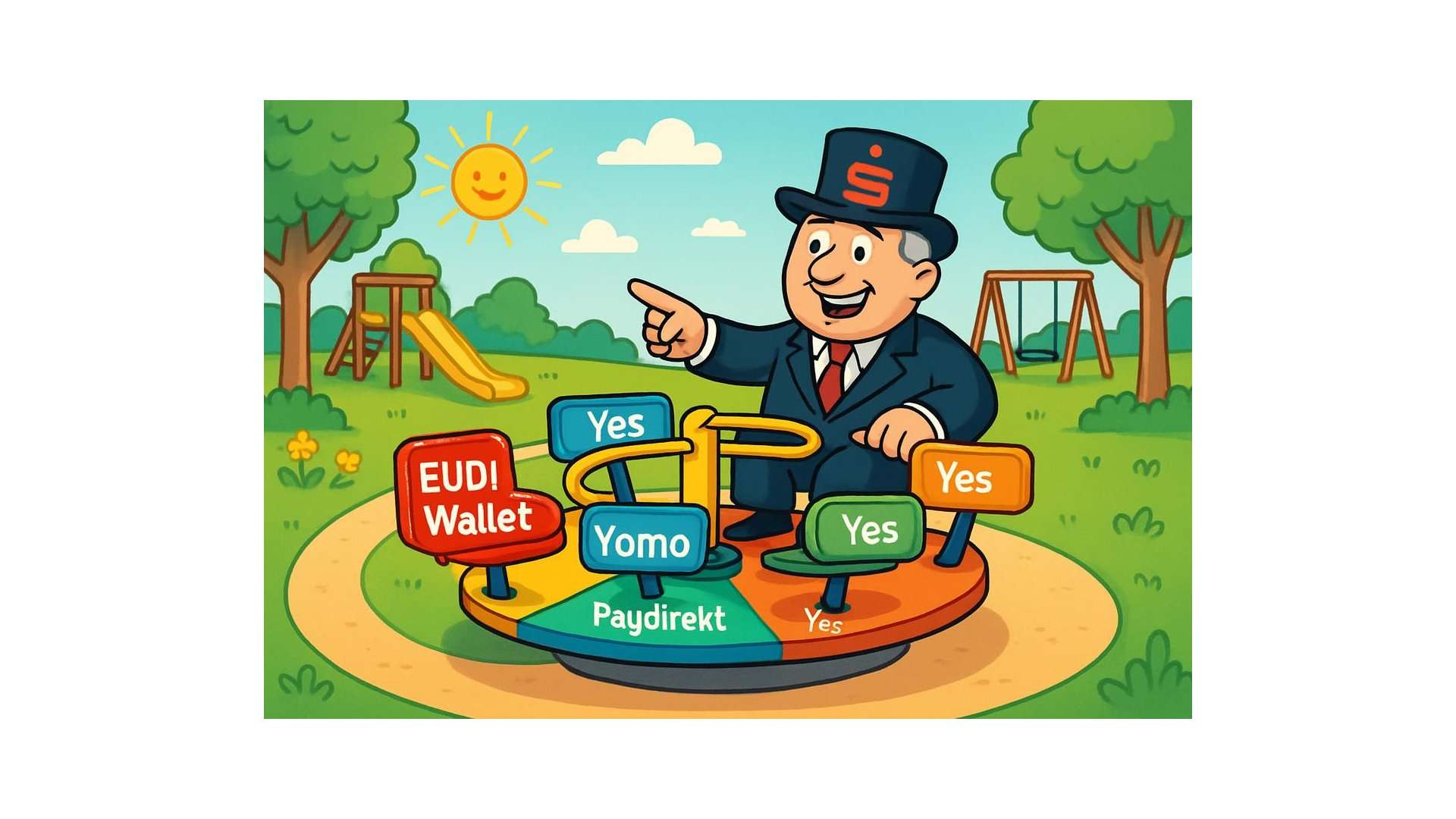Yomo scheiterte, Paydirekt scheiterte, Yes und Verimi scheiterten – und nun soll die EUDI Wallet alles anders machen. Doch das Problem der Sparkassen ist nicht mangelnder Wille, sondern ein strukturelles Dilemma: Zwischen 409 regionalen Einheiten und der Notwendigkeit digitaler Zentralisierung. Ein Beitrag über eine Organisation, die an ihrer eigenen Struktur scheitert.
Es klingt nach einer logischen Entwicklung: Die Sparkassen-Finanzgruppe integriert die EUDI Wallet und positioniert sich damit als europäischer Gegenentwurf zu Apple, Google und PayPal. Vertrauen, Regulierung, Reichweite – die klassischen Stärken der Banken scheinen wie geschaffen für die neue digitale Identitätswelt. 50 Millionen Kunden, flächendeckende Präsenz, jahrhundertealte Vertrauensbeziehungen. Die Argumentation ist bestechend. Und sie war es schon bei Yomo. Und bei Paydirekt. Und bei Yes. Und bei Verimi.
Das Problem ist nicht, dass die Sparkassen diese Argumente falsch vortragen. Das Problem ist, dass sie an einem strukturellen Dilemma scheitern, das sich nicht durch bessere Kommunikation oder mehr Investitionen lösen lässt.
Das unlösbare Dilemma: 409 gegen die Plattformlogik
Die Sparkassen-Finanzgruppe besteht aus 409 rechtlich selbstständigen Instituten. Jede Sparkasse hat eigene IT-Systeme, eigene Entscheidungsstrukturen, eigene Geschwindigkeiten. Was in der analogen Welt eine Stärke ist – regionale Verankerung, Nähe zum Mittelstand, kommunale Verwurzelung – wird im digitalen Raum zur Achillesferse.
Denn digitale Plattformen funktionieren nach einer anderen Logik. Sie brauchen Geschwindigkeit, einheitliche Nutzererfahrung, schnelle Iteration, zentrale Entscheidungen. Sie brauchen die Fähigkeit, innerhalb von Wochen Features auszurollen, A/B‑Tests zu fahren, auf Nutzerfeedback zu reagieren. Sie brauchen – und das ist der Kern – Zentralisierung.
Yomo hat dieses Dilemma exemplarisch offenbart. Die Smartphone-Bank sollte die Antwort auf N26 sein. Doch wie sollte sie organisiert sein? Als eigenständige, zentrale digitale Bank, die schnell und unabhängig agiert? Dann kollidierte sie mit dem Regionalprinzip und den Einzelinteressen der 409 Sparkassen. Jede regionale Sparkasse wollte mitreden, wollte ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigt sehen, wollte die Kontrolle über “ihre” Kunden behalten.
Oder sollte jede Sparkasse ihre eigene Yomo-Version betreiben? Dann entstand genau die Fragmentierung, die digitale Erfolge verhindert. Keine kritische Masse, keine einheitliche User Experience, kein Skalierungseffekt. Am Ende wurde Yomo zu einer App degradiert – ein Rückzug auf die sichere Position der bestehenden Kundenbeziehungen. Ein Scheitern auf Raten.
Das Muster wiederholt sich systematisch
Paydirekt sollte PayPal Paroli bieten. Das Ergebnis: Jahre der Verzögerung, komplizierte Registrierung, mangelnde Händlerakzeptanz. Wero, der europäische Neuanlauf im Payment-Bereich, kämpft mit denselben Problemen. Yes und Verimi, die beiden ID-Dienstleister der deutschen Banken, haben trotz 50 Millionen potentieller Nutzer keine kritische Masse erreicht.
Was all diese Initiativen verbindet: Sie scheitern nicht an mangelnder technischer Kompetenz oder fehlendem Kapital. Sie scheitern an der Organisationsstruktur. Die verpasste Chance wiegt dabei besonders schwer: Andreas Windisch, der als Berater selbst an paydirekt und Verimi beteiligt war, konstatierte bereits 2018: “Das Thema digitale Identitäten hätte sich großartig über die paydirekt-Plattform als gemeinsamer Ansatz der Deutschen Kreditwirtschaft lösen lassen – wäre man sich einig gewesen.”
Doch genau daran scheitert es immer wieder: an der Einigkeit. Jede Bankengruppe, jede regionale Einheit will ihr eigenes System, ihre eigene Kontrolle, ihre eigenen Regeln. Das Ergebnis ist nicht Souveränität, sondern Fragmentierung. Nicht europäische Stärke, sondern deutsche Kleinstaaterei im digitalen Raum.
Wenn Vertrauen nicht mehr ausreicht
Die Sparkassen argumentieren mit ihrem Vertrauensvorsprung. Doch im digitalen Alltag zeigt sich: Vertrauen ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. PayPal, Apple Pay und Google Pay dominieren nicht, weil Nutzer ihnen mehr vertrauen als ihrer Bank. Sie dominieren, weil sie einfacher, schneller und überall verfügbar sind.
Die “Digital Convenience” entscheidet. Während PayPal in Sekunden integriert ist und mit wenigen Klicks funktioniert, kämpfen Banklösungen mit komplexen Registrierungsprozessen, begrenzter Akzeptanz und einer User Experience, die sich anfühlt wie ein Formular aus der Vordigitalen Zeit. Sicherheit und Datenschutz werden von Nutzern vorausgesetzt – entscheidend ist, wie reibungslos die Lösung im Alltag funktioniert.
Besonders jüngere Generationen sind längst in den Ökosystemen von BigTech sozialisiert. Sie vertrauen Apple und Google nicht trotz, sondern wegen ihrer digitalen Allgegenwart. Das Vertrauen ist nicht mehr institutionell verankert, sondern funktional: Wer im Alltag reibungslos funktioniert, verdient Vertrauen. Die jahrhundertealte Marke “Sparkasse” ist kein Selbstläufer mehr, wenn die App holpert und die Konkurrenz flüssig läuft.
Die regulatorische Sackgasse
Die Sparkassen setzen auf regulatorische Absicherung. Die eIDAS 2.0‑Regulierung, die Integration von SEPA Instant Credit Transfer, die Anbindung an europäische Initiativen wie EPI – all das soll Sicherheit schaffen. Doch die regulatorische Landschaft ist selbst eine Baustelle. Die eIDAS 2.0‑Regulierung ist noch nicht abgeschlossen, der politische Prozess zum Digital Euro läuft, PSD3 steht bevor.
Während die Banken auf regulatorische Klarheit warten, setzen BigTech-Unternehmen Standards. Sie iterieren agil, testen früh, passen schnell an. Bis die Regulierung steht, haben Google und Apple die Nutzer bereits an ihre Lösungen gewöhnt. Die Regulierung kommt dann nicht als Ermöglichung, sondern als nachträgliche Legitimierung bestehender Fakten.
Hinzu kommt die organisatorische Unsicherheit innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe selbst. Ohne klare Governance, ohne zentrale Entscheidungsmacht, ohne die Fähigkeit, schnell und einheitlich zu agieren, entstehen Investitionsrisiken, die jede Digitalinitiative von Beginn an belasten.
Das Geschäftsmodell-Problem
Ein EUDI Wallet ist technologisch und regulatorisch anspruchsvoll. Die Investitionen sind erheblich: Entwicklung der technischen Infrastruktur, Integration in bestehende Systeme, Sicherheitsarchitektur, Compliance-Strukturen, Schulung der Mitarbeiter, Marketing für die Nutzerakzeptanz. Mehrere hundert Millionen Euro müssen aufgebracht werden – bei den Sparkassen verteilt auf 409 Institute mit unterschiedlicher Finanzkraft.
Doch wie soll sich das rechnen? Das Geschäftsmodell bleibt diffus. Die Wallet selbst wird vermutlich kostenlos sein müssen – alles andere würde Nutzer abschrecken, wenn Apple und Google ihre Lösungen gratis anbieten. Bleibt es also beim “Verteilermodell”, bei dem Banken lediglich Infrastruktur bereitstellen, ohne direkte Erlöse zu generieren? Eine Art digitales Grundversorgungsangebot, das sich über Kundenbindung rechtfertigen muss?
Oder entstehen wirklich neue Umsätze? Durch Mehrwertdienste wie digitale Signaturen, Altersverifikation, Credential-Management für Unternehmen? Durch Ökosystem-Partnerschaften mit Behörden, Versicherungen, Einzelhändlern? Die Sparkassen sprechen von solchen Möglichkeiten, aber die konkreten Business Cases bleiben vage. Wer zahlt wofür? Welche Services haben echtes Umsatzpotential? Wie entwickelt man einen Marktplatz, wenn man nicht einmal eine einheitliche technische Basis hat?
Das fundamentale Problem: Während die Wallet entwickelt wird, erodiert das Kerngeschäft weiter. Schrumpfendes Filialnetz, Kostendruck, rückläufige Erträge im klassischen Bankgeschäft. Jede Sparkasse kämpft mit eigenen Herausforderungen – die eine muss Filialen schließen, die andere hat Probleme mit der IT-Modernisierung, die dritte ringt mit Personalabbau. Unter diesen Bedingungen soll nun ein ambitioniertes Digitalprojekt gestemmt werden, dessen Return on Investment völlig unklar ist.
Der Blick nach Skandinavien zeigt: Es ginge anders
Dabei zeigen erfolgreiche Beispiele aus dem Ausland, dass Banken durchaus digitale Identitätslösungen etablieren können. BankID in Schweden hat über 95 Prozent Marktdurchdringung erreicht – eine Quote, von der deutsche Banken nur träumen können. In Norwegen nutzen praktisch alle Bürger BankID für digitale Behördengänge, Online-Shopping und Vertragsabschlüsse. In Dänemark ist MitID der de-facto-Standard für digitale Identifizierung.
Der Unterschied zu Deutschland ist fundamental: Die skandinavischen Banken haben verstanden, dass digitale Identität ein Infrastrukturthema ist, kein Wettbewerbsfeld. Sie haben sich auf einen gemeinsamen Standard geeinigt und diesen zentral, einheitlich und konsequent umgesetzt. Keine Fragmentierung, keine Insellösungen, keine parallelen Systeme. Die norwegischen Banken stehen gemeinsam hinter einem Verfahren. Die schwedischen Banken investieren gemeinsam in eine Lösung. Die dänischen Banken ziehen an einem Strang.
Das Ergebnis: Kritische Masse wurde erreicht, Netzwerkeffekte konnten wirken, die User Experience ist einheitlich und ausgefeilt. Behörden, Unternehmen und Plattformen integrieren BankID, weil es de facto alle erreicht. Der Lock-in-Effekt wirkt zugunsten der Banken, nicht zugunsten von Google oder Apple. Die skandinavischen Banken haben sich erfolgreich als Infrastrukturanbieter für digitale Identität positioniert – und damit BigTech aus diesem Bereich weitgehend herausgehalten.
Deutschland hingegen wiederholt seit Jahren dasselbe dysfunktionale Muster. Statt eines gemeinsamen Standards entstehen parallele Lösungen: Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Privatbanken gehen jeweils eigene Wege. Innerhalb der Bankengruppen gibt es weitere Fragmentierung – jede Sparkasse, jede Volksbank will ihre Besonderheiten berücksichtigt sehen. Das Ergebnis ist vorhersehbar: Keine der Lösungen erreicht kritische Masse, keine bietet echten Mehrwert, keine kann mit der User Experience internationaler Player mithalten. Alle zusammen verlieren gegen die zentralisierten Plattformen aus dem Silicon Valley.
Die skandinavischen Beispiele beweisen: Das Problem ist nicht technischer, sondern organisatorischer Natur. Es ist nicht mangelndes Know-how, sondern mangelnde Kooperationsfähigkeit. Es ist nicht fehlendes Kapital, sondern fehlende Einigkeit. Die deutschen Banken – und insbesondere die Sparkassen – scheitern nicht an den Herausforderungen des digitalen Zeitalters. Sie scheitern an sich selbst.
Die EUDI Wallet wird scheitern – aus denselben Gründen
Die strategische Chance ist real. Banken könnten wieder ins Zentrum der digitalen Alltagsökonomie Europas rücken, statt zu bloßen Backend-Anbietern degradiert zu werden. Für die Sparkassen-Finanzgruppe wäre der EUDI Wallet-Ansatz eine Möglichkeit, ihre Rolle als zentraler Akteur im deutsch-europäischen Finanzsystem neu zu definieren. Die Verwurzelung in der Fläche ist ein echter Vorteil, besonders für den Mittelstand und Kommunen.
Doch alle diese Chancen werden verpuffen, wenn die strukturellen Probleme nicht gelöst werden. Und diese Probleme lassen sich nicht lösen, ohne die Sparkassen-Organisation fundamental zu verändern. Die EUDI Wallet wird nicht an mangelndem Vertrauen scheitern. Sie wird nicht an fehlender Regulierung scheitern. Sie wird nicht an unzureichenden Sicherheitsstandards scheitern.
Sie wird daran scheitern, dass 409 Sparkassen nicht mit der Geschwindigkeit, Einheitlichkeit und Entschlossenheit agieren können, die digitale Plattformen erfordern. Sie wird daran scheitern, dass jede Entscheidung abgestimmt, jede Innovation verhandelt, jede Änderung durch 409 Einzelinteressen gefiltert werden muss. Sie wird daran scheitern, dass das Regionalprinzip mit der Plattformlogik unvereinbar ist.
Die unbequeme Wahrheit
Die Sparkassen stehen vor einer fundamentalen Wahl: Entweder sie lösen das strukturelle Dilemma – durch radikale Zentralisierung digitaler Initiativen, durch Abgabe regionaler Kontrolle, durch Schaffung echter Entscheidungsmacht für digitale Plattformen. Oder sie akzeptieren, dass sie im digitalen Raum keine führende Rolle spielen werden.
Halbherzige Kompromisse – wie bei Yomo, wie bei Paydirekt, wie bei Yes – führen nur zu weiteren gescheiterten Initiativen, verbranntem Kapital und erodierendem Vertrauen. Die Frage ist nicht, ob Banken die digitale Identität verwalten können. Die Frage ist, ob die Sparkassen ihre Organisationsstruktur so fundamental ändern können, dass sie im digitalen Wettbewerb bestehen.
Die bisherige Bilanz legt nahe: Sie können es nicht. Oder sie wollen es nicht. Das Ergebnis ist dasselbe. Und deshalb wird die EUDI Wallet mit hoher Wahrscheinlichkeit den Weg von Yomo, Paydirekt, Yes und Verimi gehen. Nicht weil die Idee schlecht wäre. Sondern weil die Organisation sie nicht umsetzen kann.
Die nächste gescheiterte Initiative ist bereits absehbar.
Quellen:
Sparkassen verabschieden sich von Yomo
YES und Verimi gehen zusammen
Wero: Europas neuer Anlauf gegen die digitale Abhängigkeit
Banks as natural EUDI Wallet providers: Sparkasse’s game-changing move
Sparkassen trennen sich von Verimi/Yes