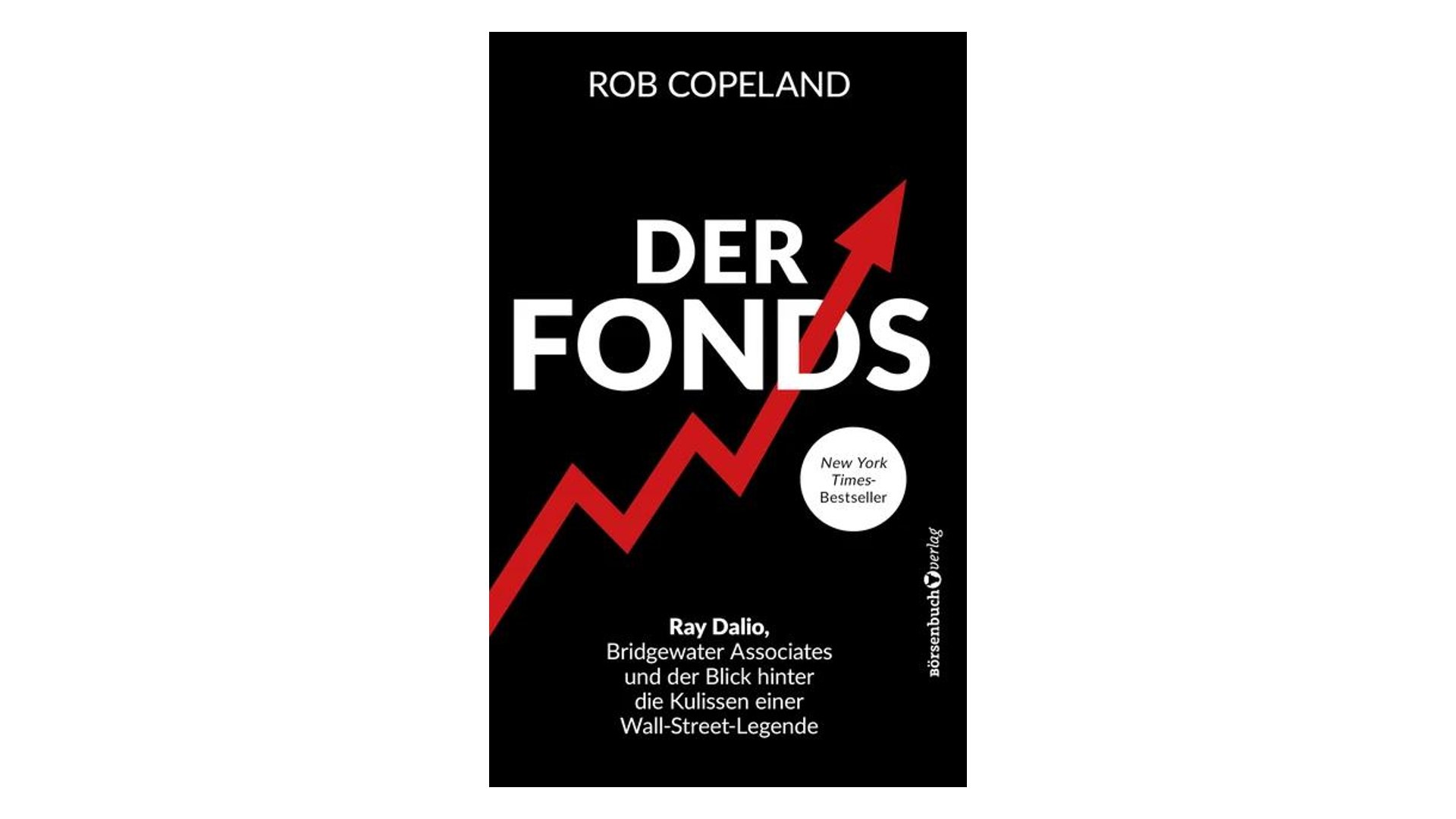Ray Dalio und sein Hedgefonds Bridgewater haben in den vergangenen 20 – 30 Jahren an der Wall Street für reichlich Furore und Gesprächsstoff gesorgt. Inzwischen sind die Defizite des von Bridgewater und seinem Gründer vertretenen Anlage- und Denkstils jedoch kaum noch zu übersehen.
Von Ralf Keuper
In dem Buch Der Fonds beschreibt der Hauptberichterstatter für Banken der New York Times, Rob Copeland, was sich beim größten Hedgefonds der Welt in den letzten Jahren alles so abgespielt hat. Dabei rückt der Gründer und CEO von Bridgewater, Ray Dalio, zwangsläufig in den Fokus.
Vor den Augen den Lesers entfaltet sich eine Welt, die deutliche Züge dessen enthält, was gemeinhin als toxische Arbeitsatmosphäre bezeichnet wird. Ray Dalio hat über die Jahre in seinem Hedgefonds ein Arbeitsklima geschaffen, das ganz bewusst auf Selektion setzt, sprich: Wer nicht erfolgreich ist bzw. wer nicht in der Lage ist, die von Dalio verfassten “Principles” ganz in sich aufzunehmen und danach zu handeln, bleibt nicht lange. Aber selbst wenn es gelingt, den Prinzipien, jedenfalls so wie sie geschrieben stehen, gerecht zu werden, bedeutet das noch lange nicht, dass einem eine längere Verweildauer im Schatten des Meisters beschieden ist. Es kommt, wie so oft, auf die Auslegung der Lehre an, und hier hat, auch das nicht selten, der Meister selbst das letzte Wort.
Dalio selbst führt den Erfolg seines Fonds auf eben diese Principles zurück, die er für ebenso zwingend wie Naturgesetze hält, wie sie etwa von Newton in Philosophiae Naturalis Principia Mathematica niedergelegt wurden.
Dalio sieht das Leben als ein System aus maschinenähnlichen, wiederkehrenden Mustern, deren realistisches Erkennen und Analyse die Basis für Erfolg bilden. Wahrheit und Akzeptanz der Realität sind zentrale Prinzipien, wobei Fehler als Lernchancen dienen. Radikale Ehrlichkeit, Transparenz und die Orientierung an objektiven Gesetzmäßigkeiten fördern individuelles und organisatorisches Wachstum. Entscheidungen basieren auf Fakten und Logik (Ideen-Meritokratie), und kontinuierliche Verbesserung steht im Fokus. Dalio betont die Wichtigkeit, eigene Prinzipien zu entwickeln, um wiederkehrende Herausforderungen effektiv zu meistern.
Copeland zeichnet das Bild einer Organisation, die weit entfernt ist von der propagierten Ideen-Meritokratie. Statt einer offenen, rationalen Diskussionskultur erkennt er autokratische Züge, sektenhafte Loyalitätsstrukturen und einen ausgeprägten Personenkult um Ray Dalio. Die vielbeschworene „Kultur der Radikalen Offenheit“ erscheint bei ihm nicht als Befreiung, sondern als Überwachungssystem – ein Régime der permanenten Bewertung und Rechtfertigung. Instrumente wie der „Dot Collector“, der jede Interaktion quantifiziert und kommentiert, verwandeln den Anspruch auf Transparenz in ein Klima der Kontrolle, in dem Kritik nicht befreit, sondern bindet.
Mehr noch: Copeland wirft Dalio vor, Loyalität über Kompetenz zu stellen und das Einverständnis mit seinen Prinzipien höher zu gewichten als unabhängiges Denken. Hinter der Fassade des rationalen Diskurses soll sich ein System persönlicher Abhängigkeiten, willkürlicher Entscheidungen und stiller Einschüchterung verbergen. Berichte über Machtspiele, Gerüchte über Belästigungen und abrupte Entlassungen verstärken das Bild einer toxischen Unternehmenskultur – einer Kultur, die weniger auf Erkenntnis als auf Gehorsam ausgerichtet ist. So kippt das Ideal einer lernenden Organisation in das Gegenteil: eine Hierarchie der Angst, verkleidet als Vernunftgemeinschaft.
All das sind Schilderungen, wie sie für sektenähnliche Gruppen typisch sind. An der Spitze steht der Guru, der die einzig wahre Lehre verkündet und selber als letzte Instanz unfehlbar ist. Es überrascht kaum, dass Dalio das anders sieht.
Versuche, die Principles in ein KI-System zu überführen, wurden nach zehnjähriger Entwicklungsarbeit, deren Leitung übrigens Dave Ferruci, der Entwickler von Watson, iinnehatte, und einem Investment von mehr als 100 Mio. Dollar aufgegeben. Die Schwierigkeiten, aus den Prinicples ein in sich konsistentes, möglichst widerspruchsfreies System zu erstellen, erwiesen sich als unüberwindbar.
Auch der Erfolg von Bridgewater ist nicht so glänzend und einmalig, wie häufig berichtet wird. Dalio ist als notorischer Pessimist bekannt, der die US-amerikanische Wirtschaft vor dem Kollaps sieht. Diese strategische Ausrichtung oder Festlegung führt nicht selten dazu, dass Dalio und seine Fonds den richtigen Zeitpunkt zum Aus- und Einstieg verpassen. Während andere Fonds so lange wie möglich Boomphasen mitnehmen und kurz vor dem Abschwung aussteigen, um dann, nachdem sich die Lage entspannt hat, langsam wieder einzusteigen, verharren Dalios Fonds zu oft und zu lange in der Defensive.
Besonders das vermeintlich „All Weather“-getaufte Portfolio und der legendäre „Pure Alpha“-Fonds, lange Zeit als Inbegriff rationaler Diversifikation und systemischer Marktintelligenz gefeiert, konnten in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren den hohen Erwartungen nicht standhalten. Wiederholt blieben sie hinter den großen Benchmarks zurück – jenen schlichten, beinahe naiv anmutenden Indexfonds wie dem MSCI World oder dem S&P 500, die ohne ausgefeilte Modelle und Makro-Thesen, schlicht durch Marktbeteiligung, beeindruckende Renditen erzielten.
Gerade die strategische Grundhaltung Bridgewaters – vorsichtig, breit gestreut, stets mit Blick auf das Unvorhersehbare – wurde zunehmend zur Schwäche. Was als Absicherung gegen systemische Schocks gedacht war, erwies sich in Phasen anhaltender Hausse als Bremsklotz. Die Fonds verpassten wesentliche Marktaufwärtsbewegungen, und auch der Anspruch, durch intelligentes Timing Ein- und Ausstieg präzise zu steuern, erfüllte sich nur selten.
So zeigen exemplarische Daten über einen Zehnjahreszeitraum ein ernüchterndes Bild: Während das Bridgewater-Portfolio lediglich rund 18,4 % Rendite erzielte, legte der MSCI World im selben Zeitraum um über 109 % zu – eine Differenz, die kaum noch als bloß zyklisches Missverhältnis erklärbar ist. In der COVID-Krise wiederum erwiesen sich Dalios Modelle, die auf makroökonomische Balance und Korrelationen zwischen Anlageklassen setzen, als erstaunlich fragil; sie konnten die Verwerfungen nicht abfedern. Schon 2015 zeigte sich Ähnliches: Als nahezu alle Assetklassen gleichzeitig fielen, blieb der versprochene „Absolute Return“ aus – das System versagte dort, wo es gerade seine Stärke hätte beweisen sollen.
Im Langfristvergleich schließlich zieht Bridgewater auch gegenüber anderen Hedgefonds und insbesondere gegenüber passiven ETF-Anlagen den Kürzeren. Was einst als Gipfel intellektueller Finanzkunst galt, erscheint heute vielen Beobachtern als überkomplexe Antwort auf eine zu einfache Frage: Lässt sich der Markt tatsächlich dauerhaft überlisten? Die nüchternen Renditen scheinen darauf eine deutliche, beinahe ironische Antwort zu geben.
Der bemerkenswerte Aufstieg von Bridgewater ist weniger einem anonymen Marktmechanismus als vielmehr einem dichten Netz persönlicher Beziehungen zu staatlichen Investoren zu verdanken. Tatsächlich zählt Bridgewater seit Jahren zu jenen Häusern, die sich auf das Vertrauen und Kapital der großen Staatsfonds – den sogenannten Sovereign Wealth Funds – stützen. Zu diesen gehören die Fonds aus Kasachstan, Brunei und Indonesien, ebenso wie aus China und den Golfstaaten. Besonders augenfällig ist der Fall Bruneis: Der dortige Staatsfonds soll mittlerweile nahezu ein Fünftel der Bridgewater-Anteile halten – ein Anteil, der nicht nur finanzielle, sondern auch strategische Nähe signalisiert.
Ray Dalio selbst gilt als Meister der Vernetzung, als jemand, der mit fast diplomatischer Geschicklichkeit Zugang zu den Machtzentren der Finanzwelt gefunden hat. Sein Name steht vor allem für eine seltene Form von Beziehungsintelligenz. In Regierungskreisen, Zentralbanken und großen Fonds wird Dalio nicht als gewöhnlicher Vermögensverwalter wahrgenommen, sondern als Ratgeber – fast als politisch-ökonomischer Gesprächspartner auf Augenhöhe. In Indonesien etwa wirkt er derzeit als offizieller Berater des neuen staatlichen Danantara-Fonds, ein Mandat, das seine Position im globalen Geflecht staatlicher Kapitalströme noch weiter festigt.
Diese Nähe zu den großen, häufig wenig transparenten Kapitalgebern verleiht Bridgewater eine Stabilität, die über die reine Performance der Fonds hinausreicht. In Zeiten, in denen Märkte schwanken und Anlegern die Nerven versagen, bleibt das Anlagevolumen der Staatsfonds beständig – getragen von langfristigen Beziehungen, institutionellem Vertrauen und der Aura persönlicher Loyalität. So erscheint der äußere Erfolg Bridgewaters nicht allein als Folge ökonomischer Exzellenz, sondern auch als Ergebnis einer stillen, strategischen Diplomatie des Kapitals: eines Beziehungsgeflechts, das das Geschäftsmodell und die Widerstandskraft des Hauses bis heute prägt.
Das ist das eigentliche “Erfolgsrezept” und das große Talent von Dalio: Seine stark ausgeprägte “Beziehungsintelligenz” und die Fähigkeit, sich in der Öffentlichkeit als eine Art Staatsmann mit ökonomischem Weitblick zu präsentieren – nicht mehr und nicht weniger.
Schlussbemerkung
Das Buch von Copeland räumt mit einer Reihe von Legenden und Mythen auf, die sich in den letzten Jahren um Bridgewater und Dalio gebildet haben und die auch von Dalio selbst mit großem Geschick gepflegt werden.
Bridgewater und Dalio sind gewiss nicht gewöhnlich und repräsentieren ein Modell, das – trotz z.T. erheblicher Defizite – den Nerv der Zeit, den Zeitgeist getroffen hat. Aber, wie das mit solchen Erfolgsmodellen so ist – sie sind eben nur auf Zeit und an bestimmte Bedingungen – und in diesem Fall an die Person Dalios – geknüpft, die vergehen.
Insofern ist davon auszugehen, dass von den Anlageprinzipien von Bridgewater ebenso wie von den Principles von Dalio nicht viel mehr als eine Erinnerung bleiben wird, die bei vielen Beobachtern neben Bewunderung auch Irritation, Kopfschütteln und vielleicht sogar Heiterkeit auslösen dürfte. Eine ähnliche Wirkung die Principia Mathematica von Newton, da legt sich der Verfasser dieser Zeilen fest, wird ihnen nicht beschieden sein. Dazu reicht es dann bei weitem nicht. Das ist dann doch eine ganz andere Liga.