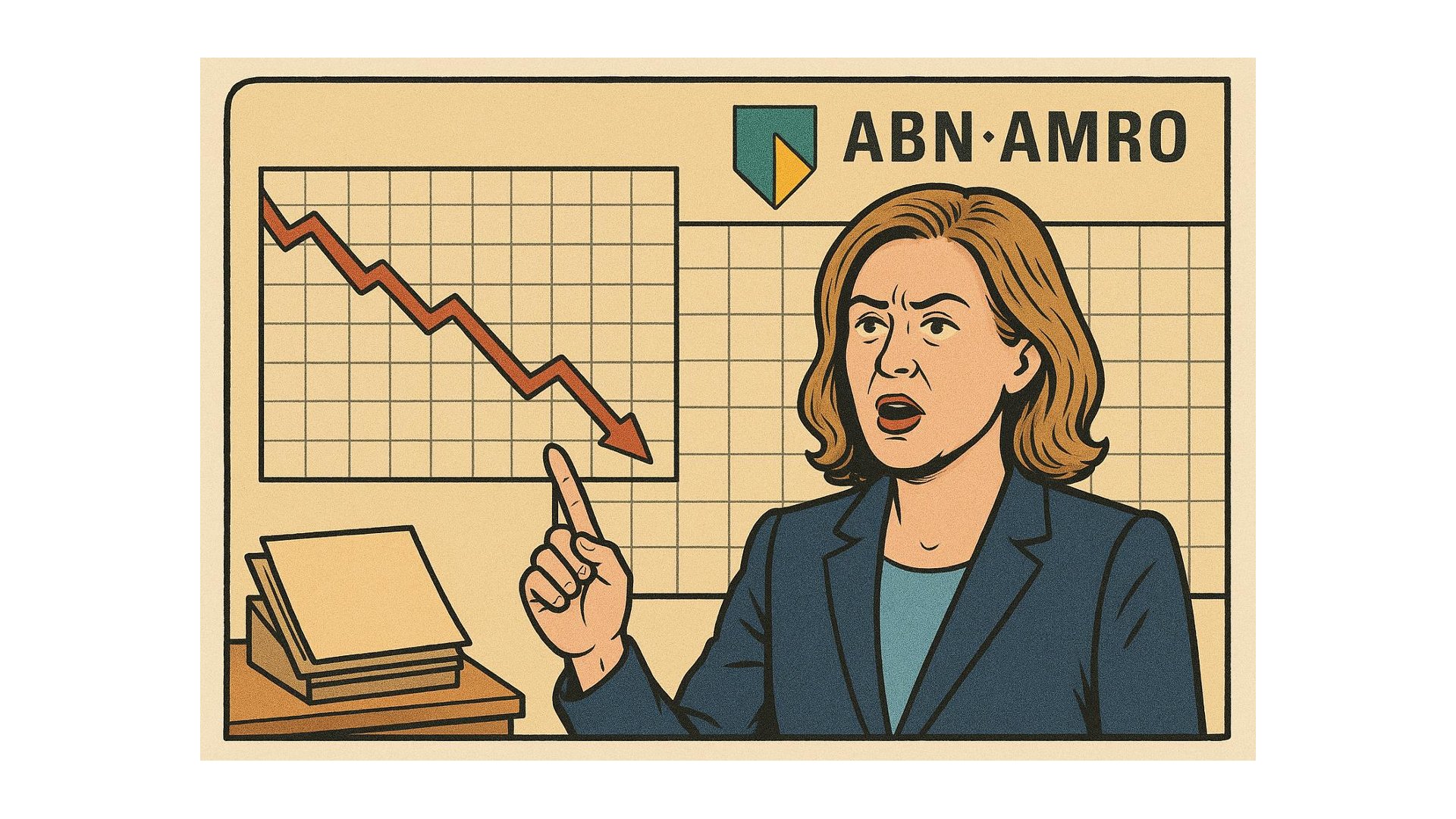Die niederländische Großbank will sich ausgerechnet auf das Hypothekengeschäft konzentrieren – in einem Marktumfeld, das diese Strategie zur Wette gegen die ökonomische Realität macht.
Die neue ABN-Amro-Chefin Marguerite Bérard hat Großes vor. Bis 2028 sollen rund 5.200 Vollzeitstellen wegfallen, fast ein Viertel der Belegschaft. Die Eigenkapitalrendite soll auf mindestens 12 Prozent steigen, das Aufwands-Ertrags-Verhältnis unter 55 Prozent sinken. Solche Zahlen klingen nach dem üblichen Repertoire einer Bankensanierung. Doch der strategische Kern des Plans offenbart ein bemerkenswertes Missverhältnis zwischen Ambition und Marktlage: ABN Amro will sich verstärkt auf das Hypothekengeschäft konzentrieren.
Das Privatkundengeschäft wurde bereits an die Rabobank verkauft, mit der Übernahme von Hauck Aufhäuser Lampe hat man sich im deutschen Private-Banking-Markt positioniert. Der Fokus auf Hypotheken soll nun stabile Erträge liefern. Was auf den ersten Blick wie solide Geschäftspolitik aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als prozyklische Fehlkalkulation.
Das Hypothekengeschäft ist derzeit eines der risikoreichsten Segmente im europäischen Bankensektor. Die gestiegenen Zinsen belasten Kreditnehmer unmittelbar, die Refinanzierung bestehender Darlehen wird für viele Haushalte zur Zerreißprobe. Hinzu kommt die konjunkturelle Schwäche, die keineswegs nur eine theoretische Gefahr darstellt. Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit ist empirisch robust belegt – das Okunsche Gesetz[1]Das Okunsche Gesetz beschreibt einen empirisch beobachteten Zusammenhang zwischen dem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Veränderung der Arbeitslosenquote. Es wurde in den … Continue reading beschreibt ihn als nahezu mechanische Beziehung[2]um diesen Zusammenhang bzw. um diese Kausalbeziehung zu erkennen, reichen eigentlich schon der gesunde Menschenverstand und ein Mindestmaß an Lebenserfahrung aus . Ein Rückgang der Wirtschaftsleistung führt nicht möglicherweise, sondern unausweichlich zu steigender Arbeitslosigkeit. Und steigende Arbeitslosigkeit führt ebenso unausweichlich zu sinkender Rückzahlungsfähigkeit bei Hypothekenschuldnern.
Die Immobilienmärkte in den Niederlanden und Deutschland, wo ABN Amro expandiert, zeigen bereits Zeichen der Korrektur. Sinkende Immobilienpreise entwerten die Sicherheiten, auf denen das gesamte Geschäftsmodell basiert. Banken, die in dieser Phase ihr Hypothekenportfolio ausbauen, setzen darauf, dass sich die wirtschaftliche Lage stabilisiert, bevor die Kreditausfälle in die Bilanzen durchschlagen. Das ist weniger eine Strategie als ein Glücksspiel mit asymmetrischem Risiko.
Gleichzeitig soll der massive Stellenabbau die Kosten senken. Mehr als die Hälfte der betroffenen Positionen will man durch natürliche Fluktuation abbauen – eine Formulierung, die verschleiert, dass Know-how und Kundenbeziehungen unwiederbringlich verloren gehen. Ausgerechnet in einem Geschäft, das von sorgfältiger Risikoprüfung und langfristiger Kundenbetreuung lebt, erscheint diese Kombination aus Expansion und Personalreduktion widersprüchlich.
Bérards Plan folgt einer Logik, die im Bankensektor verbreitet, aber nicht deshalb richtig ist: Kosten senken, auf margenstärkere Produkte setzen, ambitionierte Renditeziele kommunizieren. Die Frage, ob das gewählte Kerngeschäft zum makroökonomischen Umfeld passt, bleibt dabei eigentümlich unterbelichtet. ABN Amro wettet darauf, dass die nächsten Jahre glimpflicher verlaufen als die ökonomischen Indikatoren nahelegen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Bank diese Wette verliert.
Quellen:
ABN Amro baut Viertel der Belegschaft ab
Kahlschlag bei ABN Amro: Neue Chefin Bérard opfert 5.200 Stellen für Renditeziele
References
| ↑1 | Das Okunsche Gesetz beschreibt einen empirisch beobachteten Zusammenhang zwischen dem Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) und der Veränderung der Arbeitslosenquote. Es wurde in den 1960er Jahren vom US-Ökonom Arthur Okun formuliert. Die Hauptaussage ist, dass ein Wirtschaftswachstum, das über einer bestimmten Schwelle (dem sogenannten normalen Produktionswachstum) liegt, mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote einhergeht. Wenn das Wachstum allerdings unter dieser Schwelle bleibt, steigt die Arbeitslosigkeit.
Mathematisch heißt das: Für jedes Prozent, um das das BIP-Wachstum über dem normalen Produktionswachstum liegt, reduziert sich die Arbeitslosenquote um einen bestimmten Faktor (in Deutschland etwa 0,36 Prozentpunkte). Liegt das Wachstum unter dieser Schwelle, steigt die Arbeitslosigkeit entsprechend. Dieses Gesetz zeigt also einen negativen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Arbeitslosigkeit, der kurzfristig gut funktioniert und von Ökonomen genutzt wird, um wirtschaftliche Entwicklungen zu analysieren. Es ist allerdings kein „Gesetz“ im naturwissenschaftlichen Sinne, sondern eine statistisch beobachtete Regelmäßigkeit, die regional und zeitlich variieren kann und sich auch durch strukturelle Veränderungen der Wirtschaft wandeln kann |
|---|---|
| ↑2 | um diesen Zusammenhang bzw. um diese Kausalbeziehung zu erkennen, reichen eigentlich schon der gesunde Menschenverstand und ein Mindestmaß an Lebenserfahrung aus |