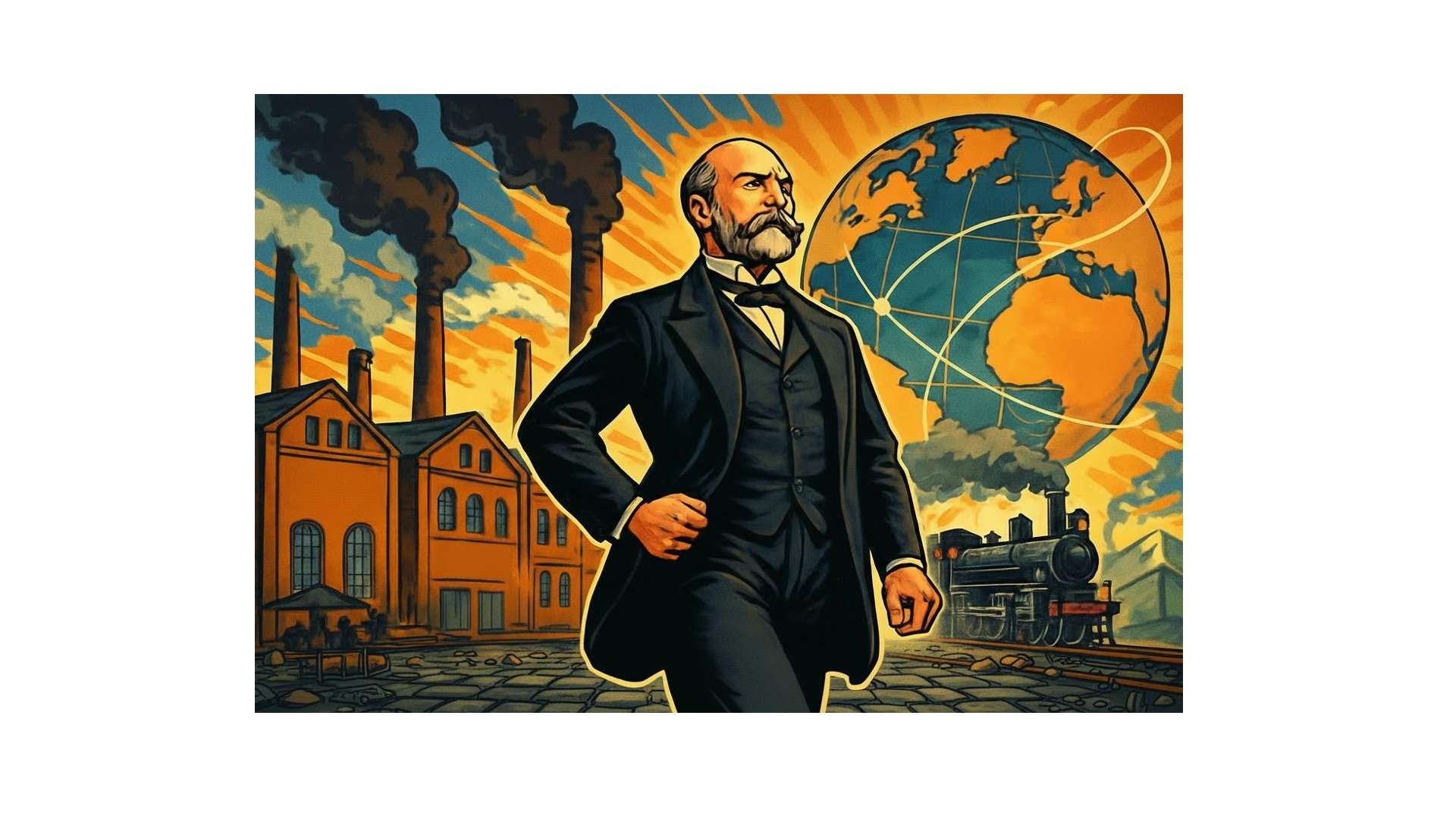Als Gründungsdirektor der Deutschen Bank formte Georg von Siemens das deutsche Bankwesen grundlegend um. Mit visionärem Weitblick schuf er die finanziellen Grundlagen für die Industrialisierung Deutschlands und etablierte ein internationales Bankennetzwerk, das seiner Zeit weit voraus war. Seine Geschichte ist die eines Mannes, der aus einer Familie von Ingenieuren stammte, aber mit dem Kapital als Werkzeug arbeitete – und damit die Zukunft einer Nation mitgestaltete.
Als Georg von Siemens im Jahr 1870 die Leitung der neu gegründeten Deutschen Bank übernahm, stand Deutschland am Beginn einer beispiellosen wirtschaftlichen Transformation. Die Reichsgründung hatte politische Einheit geschaffen, doch die industrielle Revolution verlangte nach neuen Finanzierungsinstrumenten und mutigen Bankiers, die bereit waren, über etablierte Grenzen hinauszudenken. Siemens sollte zu einem dieser Pioniere werden – nicht durch Zufall, sondern durch eine bemerkenswerte Kombination aus juristischer Präzision, unternehmerischem Wagemut und strategischem Weitblick.
Geboren 1839 in eine Familie, die durch technische Innovationen bereits Geschichte schrieb, hätte Georg von Siemens den Weg seiner berühmten Onkel Werner, Wilhelm und Carl einschlagen können. Doch während diese mit Telegrafentechnik und Elektrizität experimentierten, entdeckte er ein anderes Terrain für Innovation: die Finanzarchitektur des modernen Kapitalismus. Seine juristische Ausbildung verschaffte ihm das analytische Rüstzeug, doch es war sein Verständnis für die Dynamik zwischen Kapital und Industrie, das ihn zu einer Schlüsselfigur der deutschen Wirtschaftsgeschichte machen sollte.
Unter Siemens’ dreißigjähriger Führung entwickelte sich die Deutsche Bank von einem ambitionierten Startup zu einer der mächtigsten Finanzinstitutionen Europas. Seine Strategie war ebenso simpel wie revolutionär: Er erkannte, dass die rasante Industrialisierung enorme Kapitalmengen benötigte, die weit über das hinausgingen, was traditionelle Bankgeschäfte mobilisieren konnten. Siemens’ Antwort war die systematische Förderung des Einlagengeschäfts – eine in Deutschland damals noch wenig verbreitete Praxis. Indem er die Deutsche Bank für breitere Bevölkerungsschichten als Sparinstitution öffnete, schuf er eine Kapitalbasis, die es ermöglichte, Industriegiganten wie AEG, Mannesmann, Bayer und BASF zu finanzieren. Diese Unternehmen wurden zu Symbolen deutscher Ingenieurskunst und Wirtschaftsmacht – und die Deutsche Bank zu ihrer finanziellen Lebensader.
Doch Siemens dachte nicht in nationalen Kategorien allein. Mit einem für seine Zeit außergewöhnlichen globalen Bewusstsein trieb er die internationale Expansion der Deutschen Bank voran. Filialen in London, Paris, New York, Shanghai und Südamerika sollten die Bank in das Nervensystem der Weltwirtschaft einbinden. Diese Vision war ihrer Zeit voraus – zu weit voraus, wie sich zeigen sollte. Politische Spannungen und wirtschaftliche Turbulenzen zwangen die Bank, einige dieser Auslandsposten wieder aufzugeben. Dennoch hatte Siemens einen Standard gesetzt: Deutsche Banken sollten internationale Player sein, nicht nur Dienstleister für heimische Industrien.
Besonders faszinierend ist Siemens’ Engagement im Eisenbahnbau, jener Schlüsseltechnologie des 19. Jahrhunderts, die Kontinente erschloss und Märkte miteinander verband. Die Finanzierung der Northern Pacific Railway in den USA und der legendären Bagdadbahn im Osmanischen Reich zeigt, wie weit sein Aktionsradius reichte. Diese Projekte waren mehr als nur profitable Investitionen – sie waren geopolitische Statements, Versuche, durch Infrastruktur wirtschaftliche und politische Einflusssphären zu sichern. Die Bagdadbahn insbesondere sollte Deutschland einen Zugang zum Nahen Osten verschaffen und wurde zum Symbol deutscher imperialer Ambitionen, lange bevor die tragischen Konsequenzen solcher Großmachtpolitik offenbar wurden.
Neben seiner bankpolitischen Tätigkeit engagierte sich Siemens auch im Reichstag für die National Liberale Partei, jene politische Kraft, die für wirtschaftlichen Fortschritt und nationale Einheit stand, aber auch zunehmend mit den autoritären Tendenzen des Kaiserreichs kooperierte. Diese Doppelrolle als Bankier und Politiker war typisch für die Ära – die Grenzen zwischen Wirtschaft und Politik waren fließend, und die Eliten bewegten sich mühelos zwischen beiden Sphären.
Im Jahr 1897 vollbrachte Siemens noch eine symbolträchtige Tat: Er unterstützte die Umwandlung von Siemens & Halske, dem Unternehmen seiner Familie, in eine Aktiengesellschaft. Diese Entscheidung zeigt, wie sehr er das moderne Kapitalmodell verinnerlicht hatte – selbst das Familienunternehmen sollte sich den Mechanismen des Aktienmarkts öffnen, um Kapital für weiteres Wachstum zu mobilisieren.
Als Georg von Siemens 1901 im Alter von 62 Jahren an Krebs starb, hinterließ er nicht nur eine Frau und sechs Töchter, sondern auch ein tiefgreifend verändertes deutsches Bankwesen. Die Deutsche Bank, die er drei Jahrzehnte lang geprägt hatte, war zu einem Machtfaktor geworden, dessen Einfluss weit über die Finanzwelt hinausreichte. Ein Park in Berlin-Steglitz trägt heute seinen Namen – ein bescheidenes Monument für einen Mann, dessen eigentliches Vermächtnis in den Strukturen liegt, die bis heute das Verhältnis zwischen Kapital und Industrie, zwischen nationaler Wirtschaft und globalen Märkten prägen.
Georg von Siemens war weder ein Visionär im romantischen Sinne noch ein rücksichtsloser Kapitalist. Er war vielmehr ein Architekt – jemand, der verstand, dass wirtschaftliche Macht auf institutionellen Fundamenten ruht, die sorgfältig geplant und konsequent aufgebaut werden müssen. In einer Zeit, in der Deutschland sich anschickte, eine Weltmacht zu werden, schuf er die finanzielle Infrastruktur für diesen Aufstieg. Dass dieser Aufstieg später in Katastrophen mündete, schmälert nicht seine historische Bedeutung, sollte aber daran erinnern, dass wirtschaftliche Macht stets nach ethischer Verantwortung verlangt – eine Lektion, die im Glanz des Gründerzeit-Optimismus allzu leicht übersehen wurde.